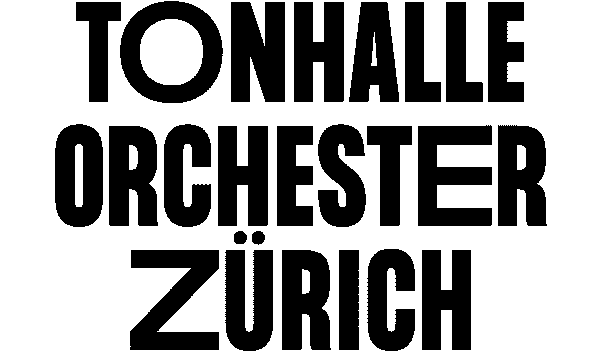«Man fühlt sich geborgen in diesem Klang»
Konzerte können emotional bewegen, Musizieren tut gut. Kein Wunder, hat die Musiktherapie tiefgreifende Wirkungen, bei psychischen wie auch bei physischen Leiden. Und sogar schon bei den ganz Kleinen.
Der Durchbruch kam im Jahr 2020, am Universitätsspital Zürich: Erstmals konnte mit bildgebenden Verfahren die Wirkung von Musiktherapie bei Frühgeborenen belegt werden. In den Gehirnen der behandelten Frühchen, so heisst es in der Studie, zeigten sich «signifikant geringere Verzögerungen in den Funktionsprozessen zwischen Thalamus und Hirnrinde, stärkere funktionale Netzwerke und ein verbessertes Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen, unter anderem in den für die Motorik und Sprache relevanten Bereichen».
Selina Kehl, die ein paar hundert Meter entfernt vom USZ im Universitäts-Kinderspital Zürich von ihrer Arbeit als Musiktherapeutin erzählt, ist froh über diese Forschungsergebnisse: «Es ist gut, dass man solche Resultate wissenschaftlich belegen kann.» Überraschend sind sie nicht für sie: «Ich sehe in der Praxis jeden Tag, was Musik bewirken kann.»
Seit 2018 arbeitet sie mit Kindern, die monatelang im Kinderspital bleiben müssen. Viele von ihnen sind Neugeborene, die mit einem Herzfehler, einer Zwerchfellhernie oder Darm-Problemen zur Welt gekommen sind. Sie haben einen stressigen Start ins Leben, vor allem, wenn sie auf der Intensivstation liegen: Ihre Betten stehen in offenen Kojen, rundherum piepsen Monitore, sie hören Schritte, Stimmen, Türgeklapper. Und immer wieder müssen sie Untersuchungen und Eingriffe über sich ergehen lassen, die ihnen niemand erklären kann.
Ein klingender Kokon
Selina Kehl spürt diesen Stress, wenn sie sich an ein Bett setzt, sie sieht ihn auf den Bildschirmen. Vielleicht fängt sie dann an zu summen und nimmt dabei den Atemrhythmus des Kindes auf. Manchmal geht sie von einem Lied aus, manchmal improvisiert sie frei. Es kann dann sein, dass sie bei einer absteigenden Melodie hängen bleibt, weil sie merkt, dass sich das Kind entspannt dabei, dass die Ausschläge auf dem Monitor ruhiger werden. Oder sie singt in die Höhe, wenn sie sieht, dass ein Neugeborenes dabei die Händchen öffnet. «Es sind oft minimale Reaktionen, die mir zeigen, was ein Kind braucht», sagt sie. «Es geht darum, diese Reaktionen zu lesen.»
Zwei, drei Mal pro Woche geht sie zu den einzelnen Kindern, «Kontinuität ist entscheidend». So lernen die Kleinen ihre Stimme kennen, das Summen und Singen wird zu etwas Vertrautem in einem Umfeld, in dem für sie so vieles unvorhersehbar ist: «Es ist wirklich eindrücklich, wie sie zur Ruhe kommen, sobald man ihnen mit den bekannten Tönen begegnet.»
Darum ist es ihr auch wichtig, möglichst oft die Eltern einzubeziehen, «deren Stimmen kannten die Kinder schon vor der Geburt». In solchen Familiensitzungen hat sie oft ein Monochord dabei, ein Instrument mit vielen Saiten, die aber nur auf zwei Töne gestimmt sind; es ist eine besonders robust lackierte Sonderanfertigung, «ein normales Holzinstrument ginge rasch kaputt, weil wir es ja ständig desinfizieren müssen». Wenn sie einem das Instrument auf die Knie legt und über die Saiten streicht, spürt man die Vibrationen, und dank den vielen Obertönen entsteht ein eigentlicher Klangraum.
Für Selina Kehl wirkt dieser Klang wie ein Kokon, «man fühlt sich geborgen und verbunden darin». Die Spitalgeräusche bleiben draussen. Und es fällt auch Eltern, die sonst nicht singen, leichter, mitzusummen oder vielleicht sogar eigene Lieder anzustimmen: «Gerade wenn sie das Kind nicht in den Arm nehmen können, ist dies eine Möglichkeit, eine Verbindung mit ihm aufzunehmen.»
Manchmal textet sie gemeinsam mit den Eltern ein Lied um. Es erzählt dann von den Wünschen und den Hoffnungen für das Kind, von den Sorgen, die man sich macht, oder auch einfach davon, was gerade passiert. Und selbst wenn die Kinder die Worte nicht verstehen: «Sie merken ganz genau, wenn sie angesprochen werden», sagt Selina Kehl. «Die Musik ist ja nicht nur da, um sie zu beruhigen: Sie gibt ihnen auch Impulse, sie schafft Nähe, weckt Interesse.»
Vom Klavier ins Kinderspital
Um all das geht es, nicht um Kunst – die erlebt Selina Kehl anderswo. Sie hat Klavier studiert, neben ihrer Arbeit im Kinderspital unterrichtet sie an der Musikschule Männedorf: «Die Musik ist ein Teil von mir, ich unterrichte gern, und es ist mir wichtig, nach wie vor selbst zu üben und zu musizieren.» Auch in Konzerten gehe es ja darum, in Kontakt mit einem Publikum zu treten; «in der Musiktherapie ist dieser Kontakt einfach noch sehr viel enger und persönlicher». Das liegt ihr.
Anfangs, so erzählt sie, sei es nicht ganz einfach gewesen im Kinderspital, «als Nichtmedizinerin musste ich mich auf der Intensivstation und im Team erst mal orientieren». Mittlerweile hat sie sich eingelebt, ihre Arbeit wird geschätzt, nicht nur bei den Ärzt*innen: «Bisher wird die Musiktherapie durch Stiftungen und Spenden finanziert, dieses Jahr nun hat das Kinderspital erstmals eine Defizitgarantie gegeben; das hat mich wirklich sehr gefreut.» Denn es zeigt, für wie wichtig man das musiktherapeutische Angebot hält, das vor sieben Jahren eingeführt wurde. «Es ist inzwischen klar, dass es nicht genügt, den Körper zu heilen», sagt Selina Kehl, «auch die Seele muss mitkommen».
Musiktherapie: Drei Jahre Ausbildung an der ZHdK
Selina Kehl und Christian Kloter haben ihre Ausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste absolviert; beide besitzen einen Master in Klinischer Musiktherapie und haben sich dafür – aufbauend auf ein Erststudium in Musik respektive Sozialpädagogik – während 3000 Stunden mit musikalischen, psychologischen, psychopathologischen, heilpädagogischen, medizinischen und kunsttherapeutischen Themen auseinandergesetzt. Auch eine musiktherapeutische Selbsterfahrung sowie Praktika und Supervision gehören dazu. Neben diesem Studium gibt es in der Schweiz vier weitere Ausbildungsgänge auf privater Basis; Absolvent*innen dieser Lehrgänge können mit einem Upgrade an der ZHdK ebenfalls einen hochschulrechtlich anerkannten Abschluss erlangen.
Die Erkenntnis ist nicht neu. Schon in der Antike wusste man um die wohltuende Wirkung der Musik. Medizinmänner unterschiedlicher Kulturen nutzten Klänge, um Menschen in Trance zu versetzen. Im süditalienischen Salento wurde die Pizzica, zu der man sich Tarantel-Gift aus dem Leib zu tanzen versuchte, zu einer eigenen musikalischen Form. Und überall auf der Welt bringt man Kinder mit Wiegenliedern zum Einschlafen.
Die Musiktherapie als solche ist aber noch eine vergleichsweise junge Disziplin, die sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts in alle möglichen Richtungen entwickelt hat. Ganz unterschiedliche Ansätze werden gelehrt, erforscht, angewandt. Grob lassen sie sich unterteilen in rezeptive und aktive Therapien. Selina Kehl arbeitet im Kinderspital oft mit rezeptiven Mitteln, weil die Kinder zu klein sind, selbst etwas zum Klingen zu bringen. Sie betont allerdings, dass selbst die Allerkleinsten stets aktive Gegenüber sind: «Sie nehmen Kontakt auf, interagieren und gestalten so die Musik indirekt mit.» Und sobald sie mit einfachem Instrumentarium hantieren können, tun sie es gern – sie versetzen ein Windspiel in Bewegung, spielen mit Rasseln, erkunden das Monochord.
Wispern, klopfen, dröhnen
Bei Christian Kloter nimmt die aktive Musiktherapie mehr Raum ein, auch im wörtlichen Sinn. Sein Atelier in Rieden bei Baden ist voller Instrumente: Da gibt es ein Cello und einen Flügel, diverse Xylophone und Trommeln, Gongs und Didgeridoos, eine Schüssel mit Maiskörnern und Saiteninstrumente, die man nicht einmal dem Namen nach kennt, kurz: alles, was es braucht, um sich wispernd, knisternd, klopfend, dröhnend oder auch melodisch bemerkbar zu machen. Man möchte am liebsten gleich spielen mit all dem, und genau darum geht es in Kloters Therapiestunden: ums Spielen, um die Freiheit, Klänge so zu gestalten, wie es gerade passt.
Das Spiel ist allerdings ernst. Wer hierher kommt, braucht Hilfe; es sind Menschen, «die den Zugang zu sich selbst verloren haben oder in quälenden Gedankenkreisen gefangen sind», sagt Christian Kloter. Sie leiden unter Depressionen, Angststörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen. «Die Musik kann sie zu ihren Emotionen führen, hinaus aus dem Denken. Sie kann etwas fühlbar machen, was vielleicht lange im Verborgenen lag, und sie leuchtet Dinge aus, die dem Intellekt allein nicht zugänglich wären.»
Auch Demenzkranke betreut er, die sich manchmal selbst dann noch an Kinderlieder erinnern, wenn sie sonst schon fast alles vergessen haben. Und er zählt auf, in welchen Fällen Musiktherapie ebenfalls helfen kann: bei Essstörungen etwa, bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder Multipler Sklerose, nach Schlaganfällen, bei Autismus-Spektrums-Störungen, Tinnitus, in der Schmerztherapie. Auch in der Palliativmedizin kommt sie zum Einsatz, dort dann meist rezeptiv: «Klang kann helfen, loszulassen.»
«Kein Gschpürschmi-Trip»
Ist Musik also ein Allheilmittel? Nein, sagt Christian Kloter; aber wie Selina Kehl ist er froh über die Forschung: «Die Wirkung ist inzwischen in vielen Bereichen wissenschaftlich nachgewiesen. Musiktherapie ist nichts Esoterisches, kein Gschpürschmi-Trip.» Beim Herumspielen mit den Instrumenten werden ganz unterschiedliche Bereiche aktiviert, physische, kognitive, soziale, manchmal auch spirituelle. Man ist in Bewegung, spürt die Vibrationen eines Instruments oder wie die Finger über die Saiten gleiten. Gleichzeitig hört man die Klänge, die man produziert, kann sie verändern, gestalten, weiterentwickeln, dem nachgehen, was sich stimmig anfühlt. In einer Gruppentherapie nimmt man auch wahr, was andere tun, wie man selbst mit ihnen in Kontakt tritt – oder eben gerade nicht.
Was dabei passiert, ist fluider und offener als das, was mit Worten auszudrücken wäre: «In der Musik sind die Dinge näher beisammen als in der Sprache.» Christian Kloter erklärt mit einem Beispiel, was das bedeutet: «Da kann jemand zum Beispiel zunächst mit einer enormen Wut auf eine Trommel schlagen. Aber plötzlich wandelt sich der Ärger um in kraftvolle, positive Energie. Daraus ergibt sich dann vielleicht eine gewisse Ruhe, und plötzlich kommt Trauer ins Spiel. Wenn der Patient oder die Patientin es zulässt, kann durch die Musik sehr vieles unmittelbar erfahrbar gemacht werden.»
Schön klingen muss das Ganze nicht, «mein Motto ist: Geben Sie sich keine Mühe». Trotzdem kommen manchmal – anders als bei Säuglingen – Erwartungen und Erfahrungen in die Quere: «Viele wissen natürlich, wie ein Cello klingen kann oder soll. Dann schlage ich ihnen jeweils vor, ein Instrument zu probieren, das sie noch nicht kennen und deshalb unbefangener erkunden können.»
Stichwort «unbefangen»: Wie trickst man Hemmungen aus? Wie holt man Menschen aus Leistungsmustern heraus, wie bringt man sie zum Singen und Spielen, wenn sie das seit Jahrzehnten nicht gemacht haben? Manchmal helfe es, sich einen Fantasieort vorzustellen, sagt Christian Kloter, «wir erkunden dann gemeinsam diesen Ort, der nichts mit unserer Welt zu tun hat und deshalb auch ganz anders klingen darf». Oder er thematisiert die Scham auch direkt. «Ich sage dann: Sie sehen ja, ich gebe hier genauso den Clown wie Sie, und es macht Spass – warum sollen wir uns den verbieten?»
Testliegen auf dem Monochord
Das klingt einfach. Dass es das nicht ist, merkt die Besucherin bei einem kleinen Test auf der Klangliege in Christian Kloters Atelier. Es ist eine Art überdimensioniertes Monochord, unter dessen Liegefläche die Saiten verlaufen. Legt man sich drauf, spürt man die Vibrationen, wird eingehüllt von diesem Klang, lässt sich hineinziehen, fühlt sich geborgen – bis einem auffällt, dass das Instrument im Quintintervall gestimmt ist und das Obertonspektrum sich ständig verändert: Damit ist der Kopf wieder aktiv, der Klangraum bricht auf, die Wirkung verblasst. Auch sich auf eine Therapie einzulassen, ist Übungssache.
Aber man kann ja klein anfangen, mit der Feststellung, dass in jeder Musik ein bisschen therapeutische Kraft steckt. Ein Konzertbesuch kann einen aufwühlen, Chorsingen kann die Laune und das Körpergefühl verbessern. Selina Kehl fällt das Improvisieren im Spital vielleicht auch deshalb leicht, weil sie Auftritte gewöhnt ist. Und für Christian Kloter ist seine in Übungskellern verbrachte Jugend ebenso wichtig wie die Erstausbildung in Sozialpädagogik. Manchmal, so erzählt er, lädt er seine ehemaligen Bandkollegen für eine Jamsession ins Riedener Atelier ein. Mit Therapie hat das dann rein gar nichts zu tun: «Aber es tut extrem gut.»
Connect: Tanzen mit neurologischen Herausforderungen
Die Tonhalle-Gesellschaft Zürich und das Opernhaus Zürich starten zusammen mit der freien Performancegruppe The Field und der Dance & Creative Wellness Foundation eine neue, für die Schweiz bisher einzigartige Kooperation. Connect heisst das Projekt; es ist ein Tanzprojekt für Menschen mit neurologischen Herausforderungen wie Multiple Sklerose oder Parkinson. Tanzen ist eine Aktivität, die sich gerade bei neurologischen Erkrankungen positiv auf das physische und psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität auswirkt. Kreativität, Leichtigkeit, Gleichgewicht, Ausdruck, Körperhaltung: All das lässt sich im Tanz neu entdecken. Die wöchentlichen Tanztrainings finden in der Tonhalle Zürich statt und werden von professionellen Tanzschaffenden mit entsprechender Expertise geleitet. Ausserdem werden Musiker*innen des Tonhalle-Orchesters Zürich in einigen Sessions künstlerisch mitwirken. Die Pilotphase des Projekts startet im Februar 2024; diese ersten Sessions sind bereits ausgebucht.