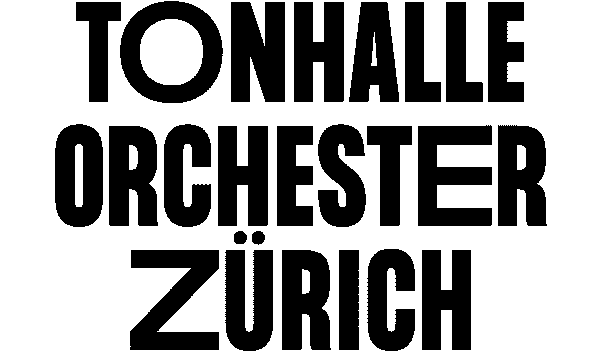Instrumente sind keine Wellnessgeräte
Dass Musizieren auf hohem Niveau zu gesundheitlichen Beschwerden führen kann, ist immer noch ein heikles Thema. Aber inzwischen ist einiges in Bewegung geraten im Bereich der Musikermedizin.
«Nach meiner zweiten Sehnenscheidenentzündung sagte mein Arzt: Beim dritten Mal wirst du die Geige aufgeben müssen. Seither bin ich extrem vorsichtig. Ich spiele oft mit Bandagen, um die Hände zu schützen.»
«Viele spielen mit Schmerzen. Manche auch mit Schmerzmitteln.»
«Es ist wie bei Pferderennen: Niemand setzt auf ein Pferd, von dem man weiss, dass es ein Problem mit einem Fuss hat. Ist einmal bekannt, dass eine Musikerin gesundheitliche Schwierigkeiten hat, wird sie nicht mehr engagiert. Auch darum ist das Thema tabu.»
Die Zitate stammen von Mitgliedern des Tonhalle- Orchesters Zürich – aber man bekäme zweifellos in jedem Orchester der Welt ähnliche zu hören. Auch der Wunsch, die Aussagen nur anonym zu verwenden, wäre überall derselbe. Dass Musizieren auf Hochleistungsniveau krank machen kann, ist immer noch ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird: Zu gross sind die Bedenken, dass es einem beruflich schaden könnte.
Dabei braucht man einem Orchester nur zuzuschauen, um festzustellen, dass die meisten Instrumente keine Wellnessgeräte sind. Geigen, Bratschen und Flöten werden asymmetrisch gehalten, die Wirbel des Cellos zwingen die Köpfe in Schräglage. Wer Fagott spielt, sitzt oft direkt vor dem Blech, auch alle anderen sind punktuell hohen Lautstärken ausgesetzt. Und während sich in den Büros allmählich Stehpulte etablieren, sitzen im Orchester zum Leidwesen ihrer Bandscheiben alle durchgehend – tagsüber in den Proben, abends im Konzert. Nur die Kontrabass-Gruppe steht und bedient mit ständig angehobener linker Hand so dicke Saiten, dass die Finger dabei erheblich strapaziert werden.
Und so weiter: Die Liste der gesundheitlichen Folgen des Musizierens ist lang. Die Oboe verlangt so hohen Ansatzdruck, dass es zu Augenschäden führen kann, Blasinstrumente allgemein können Kiefer- und Zahnprobleme verursachen. Das Risiko, wegen einer fokalen Dystonie den Gebrauch einzelner Finger zu verlieren, ist bei Musiker*innen bis zu 200 Mal höher als im Rest der Bevölkerung. Und dann sind da noch der Livedruck, der Konkurrenzdruck, die Sorge, wegen gesundheitlicher Beschwerden irgendwann die Existenzgrundlage zu verlieren: Auch die psychische Belastung ist nicht zu unterschätzen.
Wer professionell musiziert, muss sich also etwas einfallen lassen, um langfristig gesund zu bleiben. Oder sonst irgendwann einmal jemanden suchen, der fähig ist, einen wieder gesund zu machen.
«Um meinen Körper trotz stundenlangem Sitzen fit und geschmeidig zu halten, habe ich mir ein kleines Wohlfühlprogramm zusammengestellt – mit Übungen auf dem Trampolin, Yoga und Alexander-Technik.»
«Ich habe irgendwann gemerkt, dass die Ursache meiner Handprobleme im Rücken liegt. Seither mache ich zwei Mal am Tag meine Feldenkrais-Übungen zur Stabilisierung der Wirbelsäule. Wenn ich sie einmal auslasse, merke ich das sofort.»
«Es ist extrem schwierig, bei Beschwerden die richtige Therapie zu finden. Man bekommt zwar jede Menge Tipps, aber oft muss man mehrere Dinge ausprobieren, bis etwas funktioniert. Das ist nicht nur anstrengend, es wird mit der Zeit auch ziemlich teuer.»

Einer, der bei Beschwerden weiterhelfen kann, ist Mischa Greull. 30 Jahre lang spielte er als Solo-Hornist im Tonhalle-Orchester Zürich, seit einigen Monaten ist er nun vollamtlich an der Zürcher Hochschule der Künste engagiert, als Lehrer für Horn und Kammermusik – und als Teil des siebenköpfigen Musikphysiologie-Teams, das Studierende und Dozierende in gesundheitlichen Fragen berät. Es ist ein hochkarätiges Team; unter der Leitung des Violinisten und Arztes Horst Hildebrandt hat der Fachbereich mit dem etwas sperrigen Titel Musikphysiologie / Musik- und Präventivmedizin internationales Renommee erworben.
Mischa Greull selbst hatte zwar nie Schwierigkeiten, aber er kam als Lehrer mit musikphysiologischen Fragen in Kontakt: «Einer meiner Studenten hatte Probleme, gerade zu stehen. Er hat dann mit Übungen gelernt, die intrinsische Muskulatur im Fuss zu stärken und das Fussgewölbe zu stabilisieren. Das hatte Auswirkungen auf seine ganze Haltung, es hat plötzlich alles besser funktioniert.»
Damit war das Interesse geweckt, und mit der Zeit wurde es so gross, dass Mischa Greull vor einigen Jahren eine Zusatzausbildung in Musikphysiologie absolviert hat. Sein eigenes Spiel hat sich verändert dadurch, «ich habe klarere Vorstellungen davon, wie ich den Körper einsetze, wie ich in eine günstige Spielposition komme». Er weiss auch, dass es sowohl psychisch als auch physisch ein Unterschied ist, ob er zu Hause übt oder im Konzert spielt: «Auf der Bühne ist man in einer besonderen Spannung.» Deshalb gibt es an der ZHdK ein psychophysiologisches Vorspieltraining, bei dem die Studierenden mit spezifischen Fragen vor ihren Kolleg*innen auftreten: Wie komme ich auf die Bühne? An welcher Stelle kann ich atmen? Wie löse ich dieses oder jenes technische Problem? Und immer wieder: Wie kann ich unter Druck die Haltung bewahren, die Lippen kontrollieren, Verkrampfungen verhindern?
Es sei wichtig, dass man solche Themen bereits in der Ausbildung anpackt, sagt Mischa Greull: «Es ist immer besser, prophylaktisch Problemen vorzubeugen, als sie später zu lösen.» Auch die Frage, wie man sich beim Üben nicht überstrapaziert, ist im Studium zentral. Nicht alle interessieren sich dafür: Wenn man jung ist, macht der Körper noch vieles mit; die Folgen von Fehlhaltungen zeigen sich oft erst mit der Zeit. «Aber wenn dann mal etwas ist, haben wenigstens alle schon davon gehört, dass man etwas machen kann.» Und vielleicht, so die Hoffnung, sinkt mit der Zeit auch die Hemmschwelle, tatsächlich etwas zu unternehmen.
Heute ist diese Schwelle zwar bereits tiefer als früher, aber immer noch hoch. «Beschwerden zu haben ist in den Orchestern nach wie vor ein heikles Thema», sagt Mischa Greull. Er bedauert es, denn es führt auch dazu, dass sich viele erst spät melden: «Wer zu uns kommt, ist oft bereits krankgeschrieben.» Es sei ja menschlich, weiterzumachen, solange es geht, «aber besser wäre es, sich zu melden, sobald sich ein Problem abzeichnet».
Dass es möglichst viel Offenheit braucht, ist inzwischen bei vielen Orchestern klar, auch beim Tonhalle-Orchester Zürich. «Wir nehmen das Thema Gesundheit sehr ernst», sagt Intendantin Ilona Schmiel. Sie erwähnt den schalldämpfenden Vorhang während der Proben und die Finanzierung von Gehörschutz, die unterschiedlichen Aufstellungen auf der Bühne und den Wechsel zwischen grossen und kleinen Besetzungen: Alle diese Massnahmen sollen die akustische Belastung verringern oder zumindest möglichst gut verteilen. Dazu werden derzeit neue, ergonomisch günstigere Sitzkissen getestet. Und der Kontakt zu medizinischen Institutionen ist eng: Die Zusammenarbeit mit dem Musikphysiologie-Team der ZHdK hat schon zur Vermeidung von IV-Fällen geführt, «und neu planen wir ein Projekt mit der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie des Universitätsspitals Zürich».
Mischa Greull erzählt dann noch von den Workshops, die er während der Ausbildung mit «seinem» Orchester durchgeführt hat. Das Interesse daran war gross, im Orchester wie im Management-Team. Aber es wäre immer noch viel zu tun: «Musizieren auf diesem Niveau und in dieser Intensität ist Leistungssport. Es wäre sinnvoll, wenn ein Orchester ähnlich wie ein Spitzen- Fussballverein eigenes medizinisches Personal hätte.»
«Spitzensportler*innen beenden ihre Karriere mit 35, 40 Jahren. Wir spielen bis zur Pensionierung! Da ist es wichtig, dass wir fit bleiben.»
«Als ich jung war, waren gesundheitliche Probleme immer rasch wieder behoben. Jetzt dauert es viel länger.»
«Gesundheitliche Probleme werden bei uns sehr schnell existenziell. Man denkt dann: Was ist, wenn es nicht mehr gut wird?»

Auch der Bratscher Oliver Margulies gehört zum Musikphysiologie-Team der ZHdK. Er betreut unter anderem das ZZM, das Zürcher Zentrum Musikerhand – ein Handlabor, wie es das sonst nirgends gibt. Die Messgeräte, die sich darin befinden, wurden ab 1964 vom Arzt und Pianisten Christoph Wagner am Max-Planck-Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund entwickelt. Später hat Wagner in Hannover geforscht und gelehrt; nach seiner Pensionierung waren die Geräte jahrelang ausser Gebrauch, bis sie 2009 nach Zürich überschrieben wurden.
Seither messen sie hier rein mechanisch und überaus zuverlässig bis zu 100 Handeigenschaften, aus denen sich ein individuelles Handprofil erstellen lässt, das sich dann über Datenbanken mit Tausenden von Profilen gesunder Musiker*innen-Hände vergleichen lässt. Wie gross sind die Hände? Wie beweglich die Finger? Wie weit lässt sich das Handgelenk drehen? Besonders wichtig ist dabei die passive Beweglichkeit – ein Mass, das angibt, ab wann die Bewegung einen Widerstand überwinden muss.
Die Besucherin macht die Probe aufs Exempel. Der linke Daumen tut manchmal weh beim Flötespielen, Oliver Margulies misst die passive Beweglichkeit der Daumenabspreizung: 47 Grad, im gegebenen Zusammenhang eigentlich unauffällig. Aber da ist auch eine «ziemlich bemerkenswerte Überbeweglichkeit» der übrigen Finger; und da ist ein deutlich grösserer Winkel beim rechten Daumengrundgelenk. Gut möglich also, dass es tatsächlich etwas abzuklären gäbe. Nur: Hat das Problem tatsächlich mit dem Instrument zu tun? Oder eher mit der Schreibtastatur, die deutlich häufiger in Gebrauch ist? Wie ist da die Haltung des linken Handgelenks? Könnte ein Knick für unnötige Belastungen sorgen?
Über solche und viele weitere Fragen und Messungen versucht Oliver Margulies, Teilursachen für ein Problem zu eruieren. Oft liegen sie nicht dort, wo es weh tut; wenn die Schulter zieht oder der Nacken spannt, kann das mit den Händen zu tun haben. Oder umgekehrt: Wenn im Rumpf über längere Zeit etwas nicht im Lot ist beim Spielen, kann das auch Auswirkungen auf die Hand haben.
Dann gilt es, Lösungen zu suchen: Muskeln zu stärken, die Haltung zu korrigieren – oder Anpassungen am Instrument vorzunehmen. Eine andere Daumenstütze bei der Klarinette, ein anderer Kinnhalter bei den Violinen und Bratschen können schon viel bewirken.
Und, das betont auch Margulies: «Je früher man kommt, desto einfacher ist es, ein Problem zu lösen.» Dass sich inzwischen viele bereits «wegen Kleinigkeiten» melden, sieht er positiv. Aber oft sind er und seine Kolleg*innen auch mit komplexeren Fällen konfrontiert. Dazu gehören vor allem die bereits erwähnten fokalen Dystonien – neurologische Störungen, die dazu führen, dass einzelne Bewegungen nicht mehr ausgeführt werden können: «Das sind dann schon anspruchsvolle und langwierige Lösungswege.»
«Wenn man ausfällt, hat man enorme Schuldgefühle. Man will nicht fehlen, die anderen brauchen einen doch. Aber man macht sich auch Sorgen: Was ist, wenn ich irgendwann gar nicht mehr spielen kann?»
«Für uns alle ist die Lautstärke ein Thema. Man muss sich bewusst sein: Die Tonhalle Zürich wurde für ein Ensemble gebaut, das viel kleiner war und auf Darmsaiten spielte. Wenn wir jetzt in grosser Besetzung ins Fortissimo gehen, ist das eine grosse Belastung für die Ohren.»
«Es ist nicht einfach, im Orchester über gesundheitliche Probleme zu reden. Das ist ja schon sehr persönlich.»

Wenn alles nicht mehr hilft, stehen die Musiker*innen vielleicht irgendwann vor Wolfram Goertz. Er ist einerseits Musikjournalist bei der «Rheinischen Post», auch die «Zeit»-Leserschaft kennt ihn. Andererseits hat er promoviert in Theoretischer Medizin, gehört zu den Mitbegründern der Musikerambulanz am Universitätsklinikum Düsseldorf – und spielt dort als Doppelexperte in der musikalisch-medizinischen Beratung eine Schlüsselrolle.
Aus ganz Deutschland, aber auch aus der Schweiz, aus Österreich, Holland und Dänemark reisen Musiker*innen nach Düsseldorf. Viele von ihnen haben eine Odyssee hinter sich, waren bei Hausärzten, Orthopädinnen, Rheumatologen, Chiropraktikerinnen, Heilpraktikern. Hier, in der Musikerambulanz, müssen sie erst einmal spielen. Eine Untersuchung ohne Instrument habe keinen Sinn, sagt Wolfram Goertz, «man muss die Muster erkennen: Tritt das Problem auf, wenn auf der Geige die tiefe G-Saite gespielt wird? Oder hat es mit den Lagen zu tun?»
In den allermeisten Fällen seien falsche Gewohnheiten beim Üben die Ursache der Beschwerden: «Die Leute üben zu lange am Stück.» Zwanzig Minuten Spielen, fünf bis zehn Minuten Pause – «mehr ist nicht gut, mehr bringt auch nichts. Das Gehirn muss das Gelernte ja verarbeiten können». Noch schädlicher wird es, wenn man stundenlang denselben Lauf einer Chopin-Ballade repetiert, «da wechselt man zwischendrin besser mal zu einer Bach-Fuge: Die ist ebenfalls anspruchsvoll, aber die Belastung ist eine ganz andere».
Der wichtigste Tipp sei: in Bewegung bleiben, für Abwechslung sorgen. «Es gibt Orchester, in denen sitzen die Leute immer entweder rechts oder links am Pult. Nur schon mal die Seite zu wechseln, kann enorm viel bewirken.» Selbst jene Klangkörper, die wie das Tonhalle- Orchester Zürich für rotierende Positionen in den Streicherregistern sorgen, könnten aus medizinischer Sicht noch weiter gehen. Denn eigentlich wäre es ideal, wenn die ersten und die zweiten Geigen ihre Rollen gelegentlich tauschen würden; in Streichquartetten ist das mittlerweile üblich, in Sinfonieorchestern dagegen nach wie vor Zukunftsmusik.
Es gibt aber auch Probleme, die nichts mit Überlastung und Fehlhaltung zu tun haben. Da ist die Fagottistin mit Brustkrebsdiagnose, die in Düsseldorf abklären lässt, welche Variante der Operation sich am besten mit der Position des Fagott-Haltegurts vereinbaren lässt. Oder der Cellist, der als Nebenwirkung einer Chemotherapie einen Hörverlust erlitten hat. In solchen Einzelfällen werden die Abklärungen und die Therapie dann rasch einmal interdisziplinär; die Kontakte zu den anderen Abteilungen der Klinik sind eng.
Zaubern kann man allerdings auch in Düsseldorf nicht. Bei den Hörproblemen des Cellisten etwa ist offen, wie weit sie sich lösen lassen: «Man kann nur dafür sorgen, dass er alles tut, um die Durchblutung im Innenohr zu begünstigen», sagt Wolfram Goertz. «Vielleicht gibt es schon einen Fortschritt, wenn er mehr trinkt.» Auch fokale Dystonien sind Herausforderungen – «bei den Händen wissen wir inzwischen ziemlich gut, was man machen kann. Aber wenn die Lippen betroffen sind, wird es kompliziert».
Die gute Nachricht ist: In den allermeisten Fällen kann man etwas unternehmen. Die schlechte: Auch ein gelöstes Problem kann nachwirken. Das Schlimmste, sagt Wolfram Goertz, sei «die Angst vor der Angst». Wenn man einmal erlebt hat, wie wenig es braucht, bis die Berufstätigkeit und damit auch die Existenzgrundlage in Frage gestellt wird: Dann wird man dieses Gefühl so leicht nicht wieder los.
«Man gerät plötzlich in einen Teufelskreis: Wenn etwas nicht mehr wie gewohnt funktioniert, kommen Zweifel auf. Kann ich das? Bin ich gut genug? Das macht dann alles noch viel schlimmer.»
«Ich konnte ein Jahr lang nicht spielen, dann kam ich zurück. Sechs Monate lang ging alles gut – dann hatte ich einen Rückfall. Das war noch viel schlimmer: zu wissen, dass das immer wieder kommen kann.»
«Im Orchester zu spielen ist das Schönste für mich, das ist mein Leben. Die Vorstellung, dass ich das vielleicht einmal nicht mehr tun könnte, ist wirklich erschreckend.»